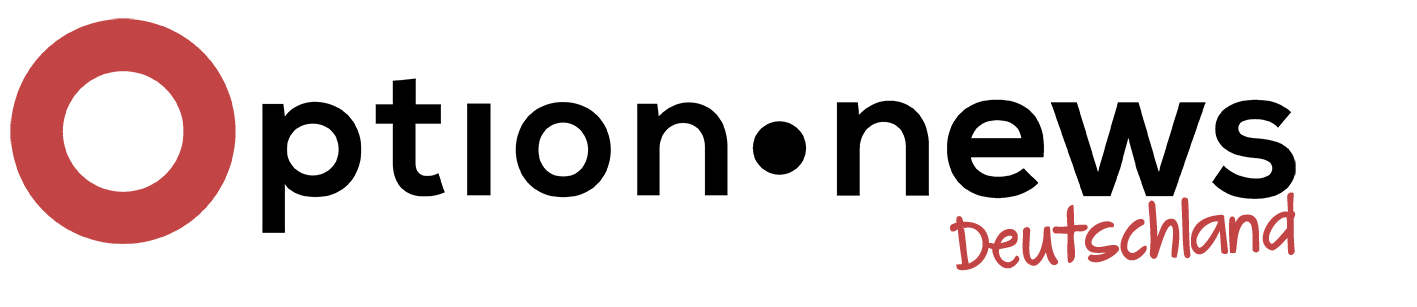Unsere Ernährungsgewohnheiten sind nicht nur ungesund. Sie heizen auch das Klima weiter auf. Nach Angaben des Öko-Instituts werden 2050 die Hälfte der Treibhausgase aus der Landwirtschaft stammen. Hauptprobleme: Der hohe Fleischkonsum, Monokulturen, der intensive Einsatz von Pestiziden, Methan aus der und Flächenverbrauch für die Tierhaltung, die Lebensmittelverschwendung und die vielen Fertiggerichte.
In einer kleinen Serie stelle ich die Punkte vor, an denen, wir alle durch eine veränderte Ernährungsweise ohne viel Aufwand gegen die Klimakrise wirken können
Teil 1: Fertiggerichte: Die Kehrseite der Bequemlichkeit
Packung aufreißen, Essen in die Mikrowelle, fertig ist das Mahl. Mit ihren „Convenience“ (zu deutsch: Bequemlichkeits) -Produkten erleichtert die Lebensmittelindustrie unseren Alltag – und füllt die Konten ihrer Manager und Aktionäre. Inzwischen sind zwei Drittel aller in Deutschland verbrauchten Lebensmittel industriell verarbeitet. Jeden dritten Tag gibt es in der deutschen Durchschnittsfamilie Fertigkost. Auch wenn selber Kochen wieder in ist, Kochshows im Fernsehen reichlich Publikum locken und die Menschen in Corona-Zeiten wieder mehr auf gesunde Ernährung achten: Der Trend zum Fertigessen hält an. Immer mehr Menschen leben alleine. Da lohnt sich das Kochen für viele nicht.
618.000 Beschäftigte zählt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) 2019 in der deutschen Lebensmittelindustrie. Im selben Jahr steigerte die Branche nach BMWi-Angaben ihren Umsatz um 3,2 Prozent auf 185,3 Milliarden Euro. Zwei Drittel ihrer Produkte verkauft sie auf dem heimischen Markt.
Die Ampel fürs Essen
Ob mit Fleisch, mit Fisch oder vegetarisch – die wenigsten Verbraucher verstehen, woraus genau Fertiggerichte bestehen und wie sich die Zusammensetzung auf ihre Gesundheit auswirkt. Deshalb gibt es seit Herbst 2020 nun auch in Deutschland die umstrittene „Lebensmittelampel“. Sie heißt „Nutriscore“. Mit Händen und Füßen hatte sich „Verbraucherschutz“- und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit der Industrie im Rücken dagegen gewehrt. Sie wolle den Menschen „nicht vorschreiben, was sie essen sollen“. In einer Umfrage ihres Ministeriums sahen das die meisten Bürgerinnen und Bürger anders: Neun von zehn wünschten sich die Kennzeichnung als schnell und intuitiv verständlich. 85 Prozent gaben an, eine Lebensmittelampel helfe beim Vergleich der Waren.
Nun dürfen die Lebensmittelhersteller selbst entscheiden, ob sie den Nutriscore auf ihre Produkt-Packungen drucken. Anders als eine Ampel in den drei Farben grün (gesund), gelb (mittel) und rot (ungesund) differenzieren die Angaben zwischen A (gesund) und E (ungesund). Pluspunkte gibt es für einen hohen Protein (Eiweiß) -Anteil, Ballaststoffe, Nüsse, Obst- und Gemüse im Produkt. Negativ schlagen sich Salz, Zucker und hohe Kalorienzahl nieder.
Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat im Frühjahr 2019 identisch aussehende Fertig-Lebensmittel verglichen und nach den Regeln des Nutriscore bewertet. Dabei ging die Note A an ein billiges Müsli von Edeka und ein schwaches D an ein deutlich teureres von Kellogs: „Gründe sind der hohe Anteil gesättigter Fette, der geringere Fruchtanteil, die höhere Kalorienzahl sowie mehr Zucker und Salz“, berichtet der „Spiegel“.
9.000 Kilometer für einen Becher Joghurt
Nicht berücksichtigt wird im Nutirscore die oft katastrophale Umwelt- und Klimabilanz der Produkte. Gut 9.000 Kilometer legen die Zutaten eines schwäbischen Erdbeerjoghurts auf den Straßen Europas zurück, bis der gefüllte Becher das Werk bei Stuttgart verlässt: Früchte aus Polen (oder sogar aus China) reisen zur Verarbeitung ins Rheinland. Die Joghurt-Kulturen kommen aus Schleswig-Holstein, das Weizenpulver aus Amsterdam, Teile der Verpackung aus Hamburg, Düsseldorf und Lüneburg.
Davon erfahren die Käuferin und der Käufer nichts. Auf der Packung findet sich Name und Standort der Molkerei sowie das Kürzel des Bundeslands, in dem die Kuh ihre Milch dazu gegeben hat. Dabei hat noch niemand gefragt, was die Kuh gefressen hat. Meist ist es Kraftfutter aus Sojapflanzen, die auf ehemaligen Regenwaldflächen in Brasilien gewachsen sind. Deutschland hat 2018 Lebens- und Futtermittel im Wert von 45,79 Milliarden Euro importiert. Die Statistik zählt Zutaten für Viehfutter ebenso wie Palmöl aus den abgebrannten Regenwald-Gebieten auf Borneo oder im Sommer aus Argentinien eingeflogene Äpfel. Letztere können wir im Supermarkt genauso ignorieren wie ägyptische Erdbeeren im Januar. Landen solche Produkte in Fertiggerichten, haben wir darauf wenig Einfluss. Auf der Packung steht nur, wer das Produkt wo fabriziert und abgepackt hat.
2015 berichtet der grüner Umtriebe unverdächtige „Focus“ über 11.000 Kinder in Deutschland, die sich vermutlich beim Verzehr tiefgefrorener Erdbeeren aus China den Norovirus eingefangen hatten. Titel der Geschichte: „Die absurden Wege unserer Lebensmittel“. Nach wie vor sei es für deutsche Unternehmen billiger, Nordseekrabben zum Pulen mit Lastwagen nach Marokko zu bringen, als sie vor Ort zu verarbeiten.
Geheimnisvolle Zutaten
Selbst die in der EU geschützten Herkunftsbezeichnungen lösen das Problem nicht. In deutschen Supermarktregalen liegt mehr „Schwarzwälder Schinken“, als es im Schwarzwald Schweine gibt. Die Hersteller kaufen das Fleisch billig bei Mästern im Ausland und verarbeiten es im Badischen. Damit genügen sie den Vorschriften. Selbst Verbraucherinnen und Verbraucher, die Waren aus ihrer Region kaufen wollen, haben so keine Chance. Der Focus zitiert Umfragen: Darin sagten die meisten Konsumentïnnen, sie würden für regionale, hochwertige Produkte mehr bezahlen, wenn sie wüssten, wie sie diese erkennen könnten. Mehr als drei von vier Befragten gaben an, dass sie die Qualität von Tütensuppen, Tiefkühlkost, abgepackter Wurst oder Käse aus dem Kühlregal nicht oder nur schwer beurteilen könnten. Aussehen tun sie alle gleich und die bunten Packungen versprechen mit Bildern von glücklichen Tieren in idyllischer Landschaft buchstäblich das Blaue vom Himmel. Die dreistesten Werbemärchen der Lebensmittelindustrie zeichnet die Organisation Foodwatch jedes Jahr mit dem „goldenen Windbeutel“ aus.
Die Folge des Verwirrspiels: Weil die Verbraucherïnnen nicht wissen, was genau in den Packungen steckt und woher die Zutaten kommen, kaufen sie das Billigste. Eine Untersuchung der Verbraucherzentralen bestätigte 2015, dass teure Produkte nicht unbedingt gesünder, besser oder regionaler seien als die billigen. Der höhere Preis fließe vor allem ins Marketing der Unternehmen.
Und: Wo Erdbeerjoghurt drauf steht sind nicht immer Erdbeeren drin. Viele Hersteller ersetzen Früchte durch billigere, künstlichere Aromastoffe. Zitronenkuchen enthält oft keine Zitronen, dafür womöglich Konservierungsstoffe wie das Nikotin-Abbauprodukt Cotinin oder Parabene, denen Wissenschaftlerïnnen eine hormonähnliche Wirkung nachsagen. Faustregel: „Je stärker verarbeitet das Lebensmittel ist, desto mehr Zusatz- und Aromastoffe sind in der Regel darin enthalten“, schreibt beispielsweise die Zeitschrift Stern in ihrem Ratgeber Ernährung. Wer gerne das essen möchte, was der Name eines Produkts verspricht, sollte zu Bio-Ware greifen oder gleich aus frischen, regionalen Zutaten selbst kochen. Fruchtjoghurt lässt sich aus Joghurt und Früchten leicht selbst herstellen. Frisches Obst und Gemüse kann man sehen und anfassen. Die Händler müssen auch angeben, woher sie kommen. Einziges Problem: Die oft hohen Rückstände an Pestiziden, vor allem in Nicht-Bio-Ware.
Dieser Beitrag wurde von der Option-Community erstellt. Mach mit und poste Deine Meldung!